
Krankenkäfig mit Infrarotwärmequelle und Thermostat
Allgemeines über Krankheiten und ihre Behandlung
Vorwort:
Leider können unsere gefiederten Freunde auch mal krank werden.
Oft bemerkt man dies zu spät und der Vogel stirbt an eine Krankheit,
die unter Umständen hätte geheilt werden können, wäre sie frühzeitig
behandelt worden. Hier möchte ich Ihnen einige Tipps geben, die ich
in meiner nunmehr als 15 jährigen Erfahrung mit der Zucht und Haltung
von Cardueliden gesammelt habe. Dennoch möchte ich hier darauf
hinweisen das ich keine Tierarzt bin, deshalb ist dieser Teil meiner Homepage
bitte nur als Hilfestellung zu sehen. Konsultieren Sie ggf. einen Tierarzt in ihrer
Nähe, besonders dann wenn sich die Krankheit seuchenartig im Tierbestand
ausbreitet. Tierarztsuche oder hier Tierärzte Deutschland.
Krankheitszeichen:
Zunächst gilt es, die Frage zu beantworten: „Wie zeigt ein Vogel, dass er krank ist?"
Er zeigt es durch verminderte Lebhaftigkeit, matte, trübe Augen, gesträubtes Gefieder,
bei trägem Herumhüpfen oder bei stillem Dasitzen mit untergestecktem Kopf auch am Tage.
Wenn sich dazu das Tier auf beide Beine stellt, muss man annehmen, dass es leidet.
Gesunde Vögel belasten in der Ruhe gewöhnlich nur ein Bein. Nasse, verschmutzte
oder verklebte Nasenlöcher oder Kloakenöffnung, wässrige oder schleimige Entleerungen sind weitere Krankheitszeichen. Kurzatmigkeit auch in der Ruhe, dabei rhythmische Bewegung der Flügel und des Schwanzes, Lahmheiten, Taumeln, ungewöhnliche Bewegungen, plötzliche Zahmheit sind immer bedenklich, außerdem kahle Stellen und mangelhafte Mauser.
Diese Krankheitszeichen lassen sich bei einiger Beobachtung und Schulung des Auges schon feststellen. Schwieriger wird die Frage nach dem Sitz und der Ursache des Leidens zu beantworten sein. Äußere Verletzungen, Parasiten der Haut und des Federkleides sind noch leicht festzustellen, ebenso Geschwülste und Augenkrankheiten, nicht so die inneren Leiden. Meistens ist die genaue Diagnose nicht möglich. Aber auch der weniger erfahrene Pfleger wird eine der drei großen Krankheitsgruppen erkennen:
1. Leiden der Atmungsorgane,
2. der Verdauungsorgane oder
3. des Harn- und Geschlechtsapparates (s. dort). Hat man festgestellt, dass ein Vogel sich nicht normal verhält,
prüfe man zuerst, ob es sich nur um eine Einzelerkrankung handelt oder ob mehrere, womöglich alle Tiere unter den gleichen Erscheinungen erkrankt sind. Dann besteht Verdacht auf Seuchenausbruch oder Vergiftung.

Sitzt der Vogel also lustlos und aufgeplustert in einer Volieren- oder Käfigecke sollte man das Tierchen herausfangen um es in einem geeigneten Käfig unterbringen. Am besten benutzt man einen „Krankenkäfig“ der mit einer regulierbaren Wärmequelle und einem Gitterrost ausgestatte ist. Der Rost hat den Vorteil, dass der kranke Vogel nicht mit seinem evtl. mit Bakterien und Virenverseuchten Kot in Berührung kommt und man so evtl. einer Neuansteckungvorbeugt. Der Käfigboden wird mit Zeitungspapier ausgelegt das man regelmäßig gewechselt. Gleichzeitig hat man so einen guten Überblick über die Beschaffenheit des Kots. Diese ist bei gesunden Vögel in der Regel fest, wobei immer ein flüssiger weißlicher Anteil vorhanden ist, nämlich der Urin, der ja bei Vögel zusammen mit dem Kot über die Kloake entleert wird.



Die Grabmilbe (Cnemidocoptesc) sind ca. 0,4mm groß und befallen mit Vorliebe die Beine, Füße und den Schnabel ("Schnabelräude", "Schnabelschwamm") des Wellensittichs (weniger andere Vögel) und hinterlassen eine grau-weisse, poröse schwammähnliche Wucherung, die man an den Beinen auch als "Kalkbein" bezeichnet. Die Milbe frisst sich durch die obere Haut und befällt damit auch die Federfollikel. Auch die Kloake kann von dieser kalkartige Masse befallen werden. In sehr schweren Fällen kann der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Vögel scheuern sich und reißen sich dabei oft selbst die Federn aus bei denen sie sich Verletzungen zufügen. Fichtenkreuzschnäbel und Gimpel scheinen besonders anfällig für Kalkbeinmilben zu sein.
Als Ursache diesen Befalls sieht man verminderte Widerstandskraft, vorangegangene Infektionen oder auch schlechte Haltungsbedingungen.

Darmerkrankung:
Durchfall
Nimmt man denn Vogel in die Hand und bläst das Gefieder am
Bauch zu Seite, kann man oft schon den geschwollenen Hinterleib
und die an die Bauchdecke drückenden Eingeweihte erkennen.
Zusätzlich sind oft die Federn im Bereich der Kloake stark verschmutzt.
Hier ist schnelle Hilfe angesagt, da durch den Durchfall der Wasserhaushalt
des kleinen Vogelkörpers total durcheinander gerät. Stoppt man den Durchfall
nicht trocknet der Vogel förmlich aus.
Hilfe
Man setzt den Patienten in den beheizten Krankenkäfig das mit einem
Infrarot-Dunkelstrahler ausgestattet ist. Hat die Heizung einen Thermostat
so kann dieser zu Anfang auf 26-32 C eingestellt werden. Man reiche dem Vogel als Trinkwasser kalten Kamillente und ggf. ein in der Tierhandlung zu kaufendes Präparat gegen Durchfall. Als Futter gibt man eine übliche Waldvogelfuttermischung aber auf keinen Fall frisches Grün, wie: Salat oder Vogelmiere.
Durchfall macht sich meistens in Verbindung mit Darmentzündungen bemerkbar (s. dort). Es gibt aber auch einen harmlosen Durchfall, der nervenbedingt ist und nichts mit einer Darmentzündung zu tun hat. Wenn ein Vogel zum Beispiel gefangen wurde, kann er noch stundenlang ganz flüssige, ja wässerige Ausscheidungen haben. Wird ein Vogel aus einer Gesellschaft herausgefangen, dann haben durch die Aufregung alle Vögel für kurze Zeit Durchfall. Ebenso ist es, wenn Außergewöhnliches in ihrer Nähe geschieht, etwa beim Großreinemachen, oder wenn eine Katze oder ein Greif sie in ihrer Voliere bedroht, oder sie sich zumindest bedroht fühlen. Bei dieser Art Durchfall sind keine Maßnahmen notwendig.
Er verschwindet, sobald sich die Vögel beruhigt haben.
Darmentzündungen
Darmentzündungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen unserer Kleinvögel. An dieser Krankheit aus unterschiedlichsten Ursachen sterben auch die meisten. Bei frisch importierten Vögeln ist fast immer eine Darmentzündung festzustellen oder tritt oftmals im Verlaufe der Eingewöhnung auf. Diese Vögel sind häufig in der Enge der Transportbehälter infiziert worden; sie haben durch den Stress des Fangs, Transports und der engen Unterbringung bei Händlern einen Großteil ihrer Widerstandskraft verloren. Die Umstellung auf neues Futter, das ungewohnte Klima und viele andere Faktoren spielen außerdem noch eine Rolle. Ferner kann es durch Zugluft, durch plötzliche Temperaturstürze, längere Kaltwetter- und Regenperioden und auch durch verdorbenes Futter zu Darmentzündungen kommen.
Werden viele Vögel zusammen in Gartenvolieren gehalten, was im feuchtwarmen Spätsommer häufig der Fall ist, kommt es manchmal zu ganz plötzlichen, seuchenartigen Darmerkrankungen, die durch Salmonellen und anderen Bakterien hervorgerufen werden und oft zu großen Verlusten führen. In einem solchen Fall ist sofort ein Tierarzt zu rufen, damit eine sofortige und gezielte Behandlung mit Antibiotika oder Sulfonamiden durchgeführt werden kann.
In leichten Fällen und bei Erkrankung eines Einzeltiers oder weniger Vögel kann oft mit Kamillentee, Schwarzem Tee, Vogelkohle, Vitamin-B-Komplex-Gaben und vor allem mit Wärme gut geholfen werden. Dauerwärme von 30—32 °C sind angebracht und können mit einem Infrarotstrahler, einem Dunkelstrahler oder in einem Krankenkäfig mit Heizung geboten werden. Die Behandlung sollte nicht zu früh abgebrochen werden, die Temperatur erst nach 3—5 Tagen allmählich gesenkt und auf die Normaltemperatur der Voliere oder der Vogelstube gebracht werden.
Neu erworbene Vögel sollten zuerst gesondert gehalten werden, da eine infektiöse Darmentzündung sehr ansteckend ist.
Erkältungen:
Erkältungen werden am häufigsten durch Zugluft verursacht. Auch in Gartenvolieren, die nicht weit genug abgedeckt und an den Seiten gegen Zugluft gesichert werden, kommt es nach Temperaturstürzen, bei anhaltendem kaltem Regen leicht zu Erkältungen. Diese machen sich häufig durch Niesen, wässerigen Ausfluss aus den Nasenlöchern, verschmiertes Gesichtsgefieder, häufiges Schnabelwischen auf Sitzgelegenheiten und durch Kopfschlenkern bemerkbar. Dazu kommt Atmen mit geöffnetem Schnabel, oft verbunden mit rasselnden oder pfeifenden Geräuschen. Der Vogel sitzt aufgeplustert da, hat trübe Augen und offensichtlich Fieber. Er frisst wenig, trinkt jedoch sehr viel.
Dies sollten wir nutzen, um ihm Kamillentee oder ein Antibiotikum über das Trinkwasser zu verabreichen.
Wärme ist notwendig, wie unter Darmentzündungen empfohlen. Meistens tritt im Gefolge einer Erkältung auch eine Darmentzündung ein.Wärme ist notwendig, wie unter Darmentzündungen empfohlen. Meistens tritt im Gefolge einer Erkältung auch eine Darmentzündung ein
Vorbeugung:
Sicherlich trägt eine abwechslungsreiche Ernährung zur Gesundheit ihrer gefiederten Freunde bei. Dazu gehört ausreichend Bewegung, vitaminreiches Futter. Der Verschiedenartigkeit der Vogelgruppen entsprechend, wird auch das Futter nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Allgemein gilt:
Keimfutter, Obst und Gemüse (Äpfel, Gurke, Karotten, Salat) Vogelmiere.
Weiter Faktoren sind: Frische Luft (Zugluft ist unbedingt zu vermeiden) genug Licht,
Vogelsand, ein Kalk- oder Taubenstein, eine saubere Badegelegenheit, frisches Trinkwasser und letztendlich eine, für die gehaltene Vogelart geeignete, Körnerfuttermischung. Grundsätzlich gilt, dass das angebotene Futter alle lebensnotwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge enthalten muss. Die verschiedenen Körnerarten haben z. B. einen unterschiedlichen Nährstoffgehalt. Ein Überangebot oder eine Unterbilanz kann daher leicht zu Erkrankungen führen.
Käfige und Volieren sind stets sauber zu halten. Besonders Badegelegenheiten, Tränken und Futterstellen müssen täglich gereinigt werden, den gerade dort finden Bakterien und Viren Gelegenheit sich zu vermehren und auszubreiten.

Abb.1 Halten der Vögel beim Krallenbeschneiden und bei der Untersuchung
Beim Zurückschneiden der Krallen nimmt man den Vogel in die linke Hand, und zwar so, dass der Kopf zwischen Daumen und Zeigefinger aus der Faust herausragt
(Abb. 1). Man hält nun den Vogelfuß gegen das Licht. Die durchsichtige Hornbedeckung lässt das letzte Zehenglied (das „Lebendige") deutlich erkennen.
Beim Schnitt soll dies nicht verletzt werden. Der Schnitt erfolgt in Richtung des Hornwachstums möglichst gleichlaufend dem unteren Rand der Kralle (Abb. 2).
Man bedient sich zu diesem Zwecke einer scharfen Schere, eines Nagelkneifers oder bei größeren, wehrhaften Vögeln wie Eulen, Greifvögeln, Papageien einer Schneidezange. Sollten bei dem Verschneiden der Kralle Blutungen entstehen, Zerfaserungen oder Zersplitterungen der Kralle, so ist die Blutung mit Eisenchloridwatte zu stillen und dann die Wunde mit Jodoformkollodium zu bestreichen; Splitter und Fasern sind mit der Schere zu entfernen.
Große oder wertvolle Tiere sollte ein Tierarzt behandeln. Um Zersplitterungen zu vermeiden, kann auch ein Hufmesser Verwendung finden.
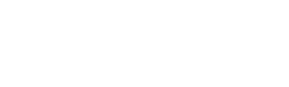
Abb.2